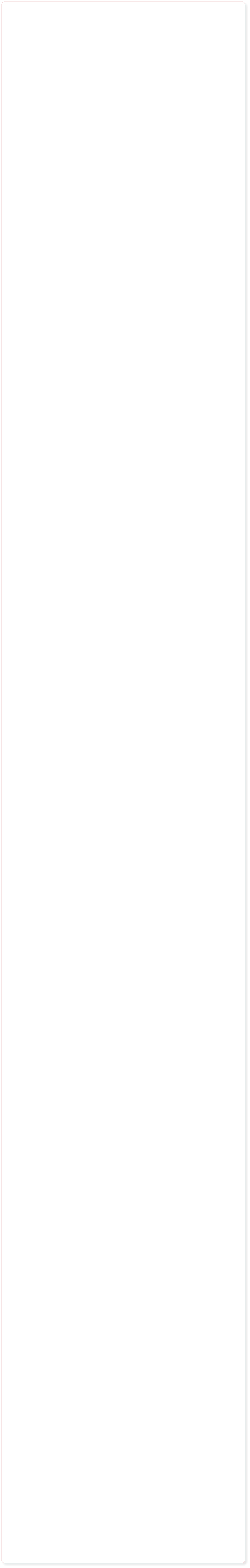


© Renate Dietrich

Kapitel 1
An
einem
Morgen
im
Januar
klang
plötzlich
alles
anders.
Was
ich
sonst
gewöhnt
war
zu
hören:
die
Geräusche
der
Stadt,
in
der
keine
Autos
fahren,
keine
Mopeds,
noch
nicht
einmal
Fahrräder,
einer
Stadt,
in
der
man
noch
die
Schritte
und
die
Stimmen
seiner Bewohner hört.
Das
Erwachen
des
Campo
di
Posto
war
mir
so
vertraut
wie
mein
eigener
Herz-
schlag.
Zuerst,
noch
mit
geschlossenen
Augen,
höre
ich
das
Rasseln
der
Ladengitter,
die
nach
oben
gezogen
werden.
Kurz
darauf
Ciaras
Stimme,
die
den
Kindern
ihre
täglichen
Ermahnungen
hinterherruft,
und
das
Lachen
der
Mädchen,
die
ihr
brav
antworten
und
doch
spätestens
an
der
nächsten
Straßenecke
alle
guten
Vorsätze
vergessen haben.
Ich
erkenne
die
gemessenen
Schritte
des
älteren
Herrn,
der
zwei
Stockwerke
unter
mir
wohnt,
und
das
hastige
Tippeln
von
Signora
Fabri,
die
sich
beeilt,
auf
ihren
hohen
Absätzen
zur
Arbeit
zu
kommen.
Kurz
danach
erscheint
Andrea,
der
Gemüsehändler
mit
seinem
hochrädrigen
Karren,
den
er
die
Brücke
hinaufzieht,
um
ihn
auf
der
anderen
Seite
klack-klack-klack
herunterrollen
zu
lassen.
Jeden
Morgen
pfeift
er
den
Kanarienvögeln
in
ihren
Käfigen
etwas
vor.
Alles
das
ist
meine
Morgenmusik,
der
Hahnenschrei, zu dem ich die Augen öffne und den neuen Tag begrüße.
An
diesem
Morgen
aber
scheinen
alle
diese
vertrauten
Töne
wie
unter
einer
dicken
Decke
erstickt
zu
sein.
Einen
Herzschlag
lang
fürchte
ich,
dass
meine
Ohren
mich
im
Stich
lassen.
Aber
dann
fühle
ich
mehr,
als
dass
ich
schon
begreife,
dass
das
ungewohnte
silberne
Flimmern,
das
das
Zimmer
erfüllt,
und
diese
seltsame
Stille
zusammengehören.
Neugierig
befreie
ich
mich
aus
der
warmen
Umarmung
meiner
Decke
und
laufe
hinüber
zum
Fenster.
Und
da
liegt
nun
zu
meinen
Füßen
eine
weiße
Welt!
Meine
geliebte
Stadt
Venedig
scheint
im
Schnee
versunken
zu
sein!
Man
hatte
mir
schon
öfter
versichert,
dass
dieses
seltene
Ereignis
zu
den
Wundern
Venedigs
gehört,
aber
ich
hatte es noch nie erlebt.
Ich
hole
meinen
Mantel,
ziehe
schnell
ein
paar
feste
Schuhe
an
und
öffne
die
Tür
zu
meiner
Dachterrasse.
Der
Blick
von
hier,
über
die
Stadt,
zur
Kuppel
des
Markusdoms
und
dem
spitzen
Finger
des
Campanile,
die
Giudecca
und,
verwaschen
gegen
einen
milchigen Himmel, die Lagune dahinter, beglückt mich jeden Morgen aufs Neue.
Dieser
Blick
über
die
Stadt
gab
den
Ausschlag,
diese
Wohnung
zu
nehmen.
Weshalb
ich
trotz
der
viel
zu
vielen
Treppen,
der
hohen
Miete,
der
Hitze
im
Sommer
und
der
Kälte
im
Winter
an
dieser
meiner
winzigen
Behausung
in
der
Ecke
eines
alten
Palazzos
mehr
hänge
als
an
nahezu
jedem
anderen
Zuhause,
das
ich
je
hatte.
Diese
Dachterrasse,
die
mir
die
Weite
und
Pracht
bietet,
die
dem
Inneren
der
Wohnung
fehlt!
Hier
fühle
ich
mich
frei
und
reich,
als
gehöre
mir
alles,
was
ich
von
hier
aus
umfassen
kann.
Ich
hatte
zuerst
Bedenken,
dass
die
Nähe
eines
Balkons,
der
zu
einer
anderen
Wohnung
gehört,
mich
stören
könnte.
In
der
Enge
der
typischen
venezianischen
Gassen
hängen
Häuser
irgendwie
aneinander
und
ein
kleiner
Teil
meiner
Terrassenbrüstung
ist
Unterbau
für
einen
Balkon,
der
auch
deshalb
einen
Meter
höher
liegt,
weil
das
andere
Haus
höher
ist
als
unseres
und
die
Stockwerke
des
anderen
Hauses nicht unseren entsprechen.
Ebenso
typisch
für
venezianische
Verhältnisse
ist,
dass
ich
noch
nicht
einmal
sicher
bin,
zu
welchem
Haus
dieser
Balkon
gehört.
Der
Eingang
zum
dem
Haus
muss
in
einer
der
kleinen
Gasse
liegen,
die
auf
den
Campo
einmünden.
Der
Aufstieg
zu
dieser
Wohnung
wird
durch
einen
ähnlichen
Irrgarten
von
Höfen
und
Treppenhäusern
führen
wie der zu meiner.
Aber
ich
habe
dort
noch
nie
einen
Menschen
gesehen.
Die
Wohnung
scheint
seit
langem
unbewohnt.
Was
leider
in
Venedig
oft
der
Fall
ist.
Obwohl
jetzt
immer
mehr
dieser
ungenutzten
Wohnungen
in
Ferienwohnungen
umgewandelt
werden.
Für
mich
ist
es
gut,
dass
niemand
den
anderen
Balkon
betritt
und
neugierig
auf
mich
herunterschaut.
So
habe
ich
diesen
Platz
unter
dem
venezianischen
Himmel
ganz
für
mich alleine.
Bis
zu
diesem
einen
märchenhaften
Tag!
Dem
Tag,
an
dem
ich
zum
ersten
Mal
erlebe,
wie
Venedig
im
Schnee
versinkt
und
für
mich
ein
großes
Abenteuer
beginnt.
Aber davon ahne ich an diesem Morgen noch nichts.
Als
erstes
rufe
ich
Signor
Marzi
an
und
bitte
ihn
um
einen
freien
Tag.
Ich
höre
ihn
am
Telefon
lächeln.
Ich
kann
ihn
tatsächlich
buchstäblich
lächeln
hören,
als
er
mich
damit
aufzieht,
dass
ich
wohl
Angst
hätte,
wegen
des
Schnees
das
Haus
zu
verlassen.
„Ganz
im Gegenteil“, versichere ich ihm, „gerade, weil ich raus möchte…“
Eigentlich
ist
es
egal,
was
er
denkt.
Ich
bin
ja
nicht
seine
Angestellte,
sondern
werde
nur
stundenweise
bezahlt.
Aber
wenn
mich
jemand
fragt,
wo
ich
arbeite,
sage
ich
immer:
„Bei
Marzis
Kunsthandel
am
Campo
San
Stefano.“
Die
Reaktion
ist
meist
ein
anerkennendes
Nicken
und
erspart
mir
zu
erklären,
dass
ich
auch
noch
für
andere
Übersetzungen
mache,
Deutschunterricht
gebe
und
ab
und
zu
putzen
gehe,
wenn
ich
die Miete noch nicht zusammen habe.
Heute
aber
nehme
ich
mir
frei
und
erobere
mir
erneut
die
geliebte
Stadt.
Alle
vertrauten
Orte
unter
unvertrautem
Weiß.
So
vieles,
täglich
gesehen,
noch
nie
Gesehenes. Bei jedem Schritt knirscht es unter meinen Füßen.
Aber
man
muss
höllisch
aufpassen.
In
die
Wege
Venedigs
sind
immer
wieder
Marmorstreifen
eingelassen,
die
man
nicht
sieht,
wenn
der
Schnee
alles
abdeckt,
die
aber
auf
eine
ganz
andere
Art
schlüpfrig
werden
als
der
übliche
Straßenbelag.
Zweimal
rutscht
mir
ein
Fuß
auf
dieser
plötzlich
glatten
Fläche
weg,
während
der
Rest
von
mir
zurückbleibt und ich mich nur mit Mühe auf den Füßen halten kann.
Also
pflüge
ich
ein
bisschen
vorsichtiger
durch
den
Schnee,
bis
der
allmählich
vergeht
und
schließlich
nur
noch
rußiger
Matsch
übrigbleibt.
Vergänglichkeit
ist
ein
Teil
des
Wunderbaren.
Glücklich
und
voll
von
den
romantischsten
Bildern
mache
ich
mich
schließlich auf den Heimweg.
Als
ich
in
unserem
Viertel
ankomme,
ist
es
schon
dunkel.
Und
dann
beginnt
es
noch
einmal
zu
schneien.
Ich
fange
die
Flocken
mit
meinen
Händen
und
auf
meiner
Zunge.
Ich
spüre
ihr
Federgewicht
auf
meinen
Augenlidern.
Ich
wirbele
mit
im
Tanz
der
Schneeflocken.
Im
Schein
der
Straßenlaterne
lächeln
Vorübergehende
über
mich.
Oder
sie
lächeln
mich
an.
Ich
bin
hier
zu
Hause
und
sie
kennen
mich.
Fremde
kommen
selten in unseren Teil der Stadt, und im Winter sind wir ganz unter uns.
Ich
laufe
die
Treppen
hinauf,
freue
mich
auf
eine
heiße
Dusche.
Im
zweiten
Stock
gibt
es
mal
wieder
kein
Licht.
Die
Lichtleitung,
die
vor
historischen
Zeiten
an
den
Rückwänden
der
Häuser
entlang
gespannt
worden
ist,
bricht
immer
wieder
an
derselben
Stelle,
und
viele
machen
die
alte
Dame
zweite
Tür
links
dafür
verantwortlich,
die
nicht
verstehen
will,
dass
es
keine
Wäscheleine
ist,
was
da
unter
ihrem
Küchen-
fenster hängt.
Mein
Gasofen
bringt
seine
unmittelbare
Umgebung
zum
Glühen,
aber
die
ungedämmten
Wände
und
die
alten
Fenster
lassen
die
Wärme
auch
gleich
wieder
raus.
In
eine
Decke
gewickelt
und
mit
einer
Tasse
dampfenden
Tees
hocke
ich
nach
der
Dusche
in
der
aufgewärmten
Mitte
des
Zimmers
und
sehe
zu,
wie
der
Schnee
auf
meine Terrasse fällt.
Dann
bemerke
ich
plötzlich,
dass
sich
in
der
Nachbarwohnung
etwas
tut.
Die
Vorhänge
in
dem
Raum,
von
dem
aus
man
den
Balkon
betreten
kann,
sind
zurück-
gezogen.
Das
Licht
schneidet
den
Schatten
eines
Menschen
aus.
Schließlich
öffnet
sich die Tür zum Balkon und er wagt einen Schritt nach draußen.
Ich
habe
den
Eindruck,
es
müsse
sich
um
einen
Mann
handeln,
aber
ich
könnte
nicht
sagen,
warum
es
mir
so
erscheint.
Der
Mensch
also,
der
vielleicht
ein
Mann
ist,
tritt
an
das
Gitter,
schaut
auf
den
Platz
hinunter
und
hebt
dann
das
Gesicht
zum
Himmel, als fange auch er die herabfallenden Flocken mit Freude.
Am
nächsten
Morgen
male
ich
Muster
in
den
Schnee,
der
in
der
vergangenen
Nacht
auf
meine
Terrasse
gefallen
ist.
Ich
höre,
dass
sich
die
Tür
der
anderen
Wohnung
erneut
öffnet,
aber
ich
drehe
mich
nicht
um.
Der
Nachbar
hustet,
als
wolle
er
auf
sich
aufmerksam
machen.
Als
ich
schließlich
zu
ihm
aufschaue,
starrt
er
in
den
Himmel,
als
wäre
es
ihm
peinlich.
Ich
rufe
ihm
ein:
„Buon
Giorno!“
zu.
Er
wirft
mir
nur
einen
Blick
zu,
nickt
kurz
und
verschwindet,
als
hätte
ich
ihn
vertrieben.
Die
Tür
schließt
sich
hinter
ihm.
‚Das
ist
aber
mal
ein
schöner
Mann!‘
geht
mir
durch
den
Kopf.
Einer,
der
einem
alten
Gemälde
entstiegen
sein
könnte.
Groß
und
wohlgeformt,
soweit
ich
sehen
kann.
Dunkle
Locken,
dunkle
Augen,
aber
dennoch
geht
etwas
Helles,
Strahlendes
von
ihm
aus.
So,
als
brenne
in
ihm
ein
silbernes
Licht.
Wie
das
Licht
der
Straßenlaternen
im
fallenden Schnee.
Signor
Marzis
Kunsthandel
am
Campo
San
Stefano
ähnelt
vielleicht
mehr
einem
Museum
als
einem
Laden.
Da,
wo
das
Publikum
unter
Glockengeläut
eintritt,
steht
nur
eine
diskrete
Theke
in
einer
gut
beleuchteten
Ecke.
Der
Rest
des
Raumes
dient
den
Kunstwerken,
die
an
den
Wänden
hängen,
in
Vitrinen
vor
jedem
Zugriff
sicher
sind
oder
im
Licht
von
Deckenspots
stehen,
so
dass
der
Betrachter
genug
Raum
hat,
sich
ihnen
von allen Seiten zu nähern.
Hinter
einem
Durchgang
liegen
die
anderen
Räume,
in
denen
der
Hauptteil
der
Geschäfte
stattfindet:
das
Büro
von
Marzi,
das
allgemeine
Büro,
in
dem
alle
sitzen,
die
hier
etwas
zu
tun
haben,
wenn
sie
gerade
einmal
anwesend
sind,
Toiletten,
das
Lager
und
der
Raum,
der
gesichert
ist
wie
ein
Safe,
und
nachts
auch
als
solcher
fungiert.
Und
unsere
wichtigste
Unterstützung
bei
der
Arbeit:
die
Kaffeemaschine
und
der
Kühlschrank!
Der
Kunsthandel,
so
wie
ihn
Signor
Marzi
betreibt,
ist
ein
diskretes
und
geheimnisvolles
Geschäft,
welches
mich
manchmal
an
Schmuggelei
erinnert,
obwohl
jeder
außer
Marzi
selbst
diesen
Vergleich
weit
von
sich
weisen
würde.
Aber
es
geschieht
nicht
selten,
dass
eine
geflüsterte
Nachricht
eintrifft,
über
die
vage
Möglichkeit,
dass
irgendwo,
in
einer
Haushaltsauflösung,
einem
Notverkauf,
auf
dem
Lande,
wo
man
sich
nicht
auskennt,
ein
seltenes
Objekt
zu
finden
sein
könnte.
Ein
Kunstwerk,
das
als
verloren
galt
oder
von
dessen
Existenz
keiner
wusste.
Dann
setzt
sich
Marzi
in
Gang
oder
er
schickt
einen
seiner
Leute,
um
Stunden
oder
Tage
später
zurückzukehren, mit Beute oder mit leeren Händen.
Signor
Marzi
kümmert
sich
persönlich
nur
um
einige
wenige
ausgesuchte
Objekte.
Er
liebt
es,
wie
ein
Spürhund
einem
Duft
zu
folgen
und
buchstäblich
Schätze
aus
dem
Dreck
zu
wühlen,
wofür
er
ein
gutes
Händchen
hat.
Den
Rest
besorgen
seine
Männer:
Francesco und Lorenzo.
Francesco
ist
eigentlich
viel
zu
alt,
um
noch
beim
Vornamen
gerufen
zu
werden,
aber
es
war
halt
immer
so.
Er
ist
schon
lange
Rentner.
Aber
er
hat
bereits
für
Marzis
Vater
gearbeitet
und
wird
nur
noch
ab
und
zu
dazu
gerufen,
wenn
es
sich
um
eine
ältere Witwe handelt, mit der komplizierte Verhandlungen geführt werden müssen.
Lorenzo
ist
Francescos
offizieller
Nachfolger
und
auch
irgendwie
verwandt
mit
ihm.
Er
ist
meist
unterwegs,
entweder
um
potentielle
und
tatsächliche
Kunden
bei
guter
Laune
zu
halten
oder
um
Bestände
in
Augenschein
zu
nehmen
und
abzuschätzen,
ob
sich
der
Ankauf
lohnen
würde.
Von
seiner
Berufsausbildung
her
ist
er
ein
Kaufmann.
Was er vom Kunsthandel versteht, hat er vor allem bei Marzi gelernt.
Im
Laden
beschäftigt
Marzi
noch
zwei
Halbtagskräfte,
die
vor
allem
Sekretariats-
und
Buchhaltungsarbeiten
erledigen.
Sie
empfangen
auch
die
Kunden,
vor
allem
um
festzustellen,
ob
diese
ernst
zu
nehmen
sind.
Falls
das
der
Fall
ist,
rufen
sie
den
Chef
oder
Lorenzo,
falls
er
gerade
einmal
da
ist.
Wenn
es
gar
nicht
anders
geht,
rufen
sie
mich.
Geht
es
nur
um
einen
schnell
abzuschließenden
Verkauf,
dürfen
sie
selbst
tätig
werden.
Ab
und
zu
beauftragt
Marzi
natürlich
auch
externe
Sachverständige,
die
je
nach
Auftrag
bezahlt
werden.
Zu
denen
kann
ich
mich
noch
nicht
zählen,
mit
meinen
paar
Semestern
Italienischer
Kunstgeschichte.
Aber
ich
arbeite
hart
daran,
meine
Kenntnisse zu erweitern und Marzi beobachtet es mit Wohlwollen.
Im
Grunde
diene
ich
ihm
stundenweise
als
‚Mädchen
für
alles‘
und
arbeite
vor
allem
als
Übersetzerin.
Marzi
selbst
spricht
selbstverständlich
mehrere
Sprachen,
jedoch
so,
dass
seine
Klugheit
es
ihm
gebietet,
seinen
natürlichen
Charme
nur
in
persönlichen
Begegnungen
spielen
zu
lassen,
und
sich
schriftlich
lieber
unzweideutiger
auszu-
drücken.
Meine
fachlichen
Kenntnisse
in
verschiedenen
Sprachen
sind
dafür
ausrei-
chend und wenn nicht, so ist er immer bereit, mir zu erklären, worum es geht.
Manchmal
denke
ich,
er
beschäftigt
mich
auch
deshalb,
weil
er
ein
bisschen
Mitleid
mit
mir
hat,
und
es
genießt,
ein
solch
armes
Geschöpf
wie
mich
am
Leben
zu
halten.
Das
mag
auch
daran
liegen,
dass
er
zwar
zwei
Söhne
hat,
aber
irgendwie
eine
Tochter
vermisst.
Tatsächlich
ist
er
ein
fast
immer
korrekter
Arbeitgeber,
der
sich
nur
in
schwachen
Stunden
einen
Anfall
von
feinem
Humor
gestattet
oder
auch
einmal
einen
Wutanfall. Je nachdem.
Hin
und
wieder
wage
ich
es,
ihn
darauf
aufmerksam
zu
machen,
dass
ich
ihm
noch
viel
nützlicher
sein
könnte,
wenn
er
sich
dazu
durchringen
könnte,
mir
eine
feste
Stelle
zu
geben,
aber
auf
diesem
Ohr
ist
er
so
gut
wie
taub.
Mir
geht
es
ja
nicht
nur
um
das
Gehalt,
obwohl
ich
schon
lange
nicht
mehr
die
Nase
über
die
Sicherheit
eines
festen
Einkommens
rümpfen
würde.
Es
ist
auch,
weil
ich
finde,
dass
es
für
mich
langsam
Zeit
wird,
mir
eine
Berufsbezeichnung
zuzulegen,
anstatt
mich
von
zufälligem
Job
zu
zufälligem
Job
zu
hangeln.
Ein
Magister
in
Romanistik
ist
noch
nicht
einmal
als
Titel
besonders eindrucksvoll, als Berufsbeschreibung ist er völlig untauglich.
Im
Handel
mit
Kunst
verbände
sich
mein
Interesse
für
Italien
und
für
die
italienische
Kunst
mit
einer
durchaus
praktischen
Seite.
Da
geht
es
einmal
darum,
etwas
zu
entdecken,
was
sehr
spannend
sein
kann,
und
andererseits
darum,
welche
Preise
sich
erzielen
lassen,
als
Käufer
oder
als
Verkäufer.
Ich
könnte
mir
einen
Berufsweg
im
Kunsthandel absolut vorstellen.
Aber
so
wie
die
Dinge
liegen,
stehe
ich
ihm,
wie
jedem
anderen
auch,
nur
stundenweise
zur
Verfügung.
Romantiker
nennen
das:
Freiheit.
Aber
es
hat
wenig
davon.
Immer
wieder
Jobs
zu
finden,
ist
nicht
einfach,
und
obwohl
sich
meine
Auftraggeber
der
Freiheit
erfreuen,
mich
zu
nehmen
oder
mich
abzulehnen,
kann
ich
mir den Luxus, einen Auftrag abzulehnen, nur selten leisten.
Heute
mache
ich
die
monatliche
Auswertung
internationaler
Zeitschriften.
Was
Signor
Marzi
interessiert,
ist
jede
Art
von
Hinweis,
je
versteckter,
desto
besser,
in
denen
Kunstwerke
nicht
ganz
gewisser
Herkunft
gemeldet
werden,
ebenso
wie
Veröffentlichungen
über
halbbekannte
oder
unbekannte
Künstler.
Denn
Signor
Marzi
handelt
nicht
nur
mit
Kunstwerken,
er
sammelt
auch
selbst,
wobei
das
Bedürfnis
nach
ästhetischem
Genuss
und
gewinnbringender
Investition
sich
durchaus
die
Waage
halten.
Als
ich
von
der
Arbeit
nach
Hause
komme,
ist
es
schon
dunkel.
Auf
der
Dach-
terrasse
liegt
immer
noch
Schnee,
aber
er
ist
zusammengebacken.
Keine
lockere
Flockigkeit
mehr.
In
der
Nachbarwohnung
sind
die
Vorhänge
noch
nicht
zugezogen
und
so
kann
ich
den
neuen
Nachbarn
in
einem
Zimmer
sehen,
das
eine
Art
Wohnzimmer
oder
Salon
zu
sein
scheint.
Im
Licht
der
Deckenlampe
steht
er
dort.
Seine
Aufmerk-
samkeit
ist
auf
einen
Punkt
konzentriert,
der
sich
meinem
Blick
entzieht,
aber
ich
habe
nicht
den
Eindruck,
als
gelte
sein
Interesse
einem
dort
Sitzenden.
Im
Gegenteil,
er
erweckt
den
Eindruck,
auf
eine
sehr
grundsätzliche
Weise
allein
zu
sein,
und
ich
fühle
so etwas wie Mitleid, wie man es mit einem Tauben oder Blinden empfindet.
Venezianischer Schnee - Leseprobe

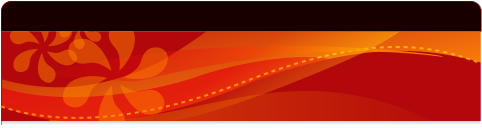


© Renate Dietrich
Venezianischer Schnee - Leseprobe
Kapitel 1
An
einem
Morgen
im
Januar
klang
plötzlich
alles
anders.
Was
ich
sonst
gewöhnt
war
zu
hören:
die
Geräusche
der
Stadt,
in
der
keine
Autos
fahren,
keine
Mopeds,
noch
nicht
einmal
Fahrräder,
einer
Stadt,
in
der
man
noch
die
Schritte
und
die
Stimmen
seiner
Bewohner hört.
Das
Erwachen
des
Campo
di
Posto
war
mir
so
vertraut
wie
mein
eigener
Herzschlag.
Zuerst,
noch
mit
geschlossenen
Augen,
höre
ich
das
Rasseln
der
Ladengitter,
die
nach
oben
gezogen
werden.
Kurz
darauf
Ciaras
Stimme,
die
den
Kindern
ihre
täglichen
Ermahnungen
hinterherruft,
und
das
Lachen
der
Mädchen,
die
ihr
brav
antworten
und
doch
spätestens
an
der
nächsten
Straßenecke
alle
guten
Vorsätze
vergessen haben.
Ich
erkenne
die
gemessenen
Schritte
des
älteren
Herrn,
der
zwei
Stockwerke
unter
mir
wohnt,
und
das
hastige
Tippeln
von
Signora
Fabri,
die
sich
beeilt,
auf
ihren
hohen
Absätzen
zur
Arbeit
zu
kommen.
Kurz
danach
erscheint
Andrea,
der
Gemüsehändler
mit
seinem
hochrädrigen
Karren,
den
er
die
Brücke
hinaufzieht,
um
ihn
auf
der
anderen
Seite
klack-klack-
klack
herunterrollen
zu
lassen.
Jeden
Morgen
pfeift
er
den
Kanarienvögeln
in
ihren
Käfigen
etwas
vor.
Alles
das
ist
meine
Morgenmusik,
der
Hahnenschrei,
zu
dem ich die Augen öffne und den neuen Tag begrüße.
An
diesem
Morgen
aber
scheinen
alle
diese
vertrauten
Töne
wie
unter
einer
dicken
Decke
erstickt
zu
sein.
Einen
Herzschlag
lang
fürchte
ich,
dass
meine
Ohren
mich
im
Stich
lassen.
Aber
dann
fühle
ich
mehr,
als
dass
ich
schon
begreife,
dass
das
ungewohnte
silberne
Flimmern,
das
das
Zimmer
erfüllt,
und
diese
seltsame Stille zusammengehören.
Neugierig
befreie
ich
mich
aus
der
warmen
Umarmung
meiner
Decke
und
laufe
hinüber
zum
Fenster.
Und
da
liegt
nun
zu
meinen
Füßen
eine
weiße
Welt!
Meine
geliebte
Stadt
Venedig
scheint
im
Schnee
versunken
zu
sein!
Man
hatte
mir
schon
öfter
ver-
sichert,
dass
dieses
seltene
Ereignis
zu
den
Wundern
Venedigs gehört, aber ich hatte es noch nie erlebt.
Ich
hole
meinen
Mantel,
ziehe
schnell
ein
paar
feste
Schuhe
an
und
öffne
die
Tür
zu
meiner
Dach-
terrasse.
Der
Blick
von
hier,
über
die
Stadt,
zur
Kuppel
des
Markusdoms
und
dem
spitzen
Finger
des
Campanile,
die
Giudecca
und,
verwaschen
gegen
einen
milchigen
Himmel,
die
Lagune
dahinter,
beglückt
mich jeden Morgen aufs Neue.
Dieser
Blick
über
die
Stadt
gab
den
Ausschlag,
diese
Wohnung
zu
nehmen.
Weshalb
ich
trotz
der
viel
zu
vielen
Treppen,
der
hohen
Miete,
der
Hitze
im
Sommer
und
der
Kälte
im
Winter
an
dieser
meiner
winzigen
Behausung
in
der
Ecke
eines
alten
Palazzos
mehr
hänge
als
an
nahezu
jedem
anderen
Zuhause,
das
ich
je
hatte.
Diese
Dachterrasse,
die
mir
die
Weite
und
Pracht
bietet,
die
dem
Inneren
der
Wohnung
fehlt!
Hier
fühle
ich
mich
frei
und
reich,
als
gehöre
mir
alles,
was ich von hier aus umfassen kann.
Ich
hatte
zuerst
Bedenken,
dass
die
Nähe
eines
Balkons,
der
zu
einer
anderen
Wohnung
gehört,
mich
stören
könnte.
In
der
Enge
der
typischen
venezia-
nischen
Gassen
hängen
Häuser
irgendwie
aneinander
und
ein
kleiner
Teil
meiner
Terrassenbrüstung
ist
Unterbau
für
einen
Balkon,
der
auch
deshalb
einen
Meter
höher
liegt,
weil
das
andere
Haus
höher
ist
als
unseres
und
die
Stockwerke
des
anderen
Hauses
nicht unseren entsprechen.
Ebenso
typisch
für
venezianische
Verhältnisse
ist,
dass
ich
noch
nicht
einmal
sicher
bin,
zu
welchem
Haus
dieser
Balkon
gehört.
Der
Eingang
zum
dem
Haus
muss
in
einer
der
kleinen
Gasse
liegen,
die
auf
den
Campo
einmünden.
Der
Aufstieg
zu
dieser
Woh-
nung
wird
durch
einen
ähnlichen
Irrgarten
von
Höfen
und Treppenhäusern führen wie der zu meiner.
Aber
ich
habe
dort
noch
nie
einen
Menschen
gesehen.
Die
Wohnung
scheint
seit
langem
unbe-
wohnt.
Was
leider
in
Venedig
oft
der
Fall
ist.
Obwohl
jetzt
immer
mehr
dieser
ungenutzten
Wohnungen
in
Ferienwohnungen
umgewandelt
werden.
Für
mich
ist
es
gut,
dass
niemand
den
anderen
Balkon
betritt
und
neugierig
auf
mich
herunterschaut.
So
habe
ich
diesen
Platz
unter
dem
veneziani-schen
Himmel
ganz
für
mich alleine.
Bis
zu
diesem
einen
märchenhaften
Tag!
Dem
Tag,
an
dem
ich
zum
ersten
Mal
erlebe,
wie
Venedig
im
Schnee
versinkt
und
für
mich
ein
großes
Abenteuer
beginnt.
Aber
davon
ahne
ich
an
diesem
Morgen
noch
nichts.
Als
erstes
rufe
ich
Signor
Marzi
an
und
bitte
ihn
um
einen
freien
Tag.
Ich
höre
ihn
am
Telefon
lächeln.
Ich
kann
ihn
tatsächlich
buchstäblich
lächeln
hören,
als
er
mich
damit
aufzieht,
dass
ich
wohl
Angst
hätte,
wegen
des
Schnees
das
Haus
zu
verlassen.
„Ganz
im
Gegenteil“,
versichere
ich
ihm,
„gerade,
weil
ich
raus
möchte…“
Eigentlich
ist
es
egal,
was
er
denkt.
Ich
bin
ja
nicht
seine
Angestellte,
sondern
werde
nur
stundenweise
bezahlt.
Aber
wenn
mich
jemand
fragt,
wo
ich
arbeite,
sage
ich
immer:
„Bei
Marzis
Kunsthandel
am
Campo
San
Stefano.“
Die
Reaktion
ist
meist
ein
aner-
kennendes
Nicken
und
erspart
mir
zu
erklären,
dass
ich
auch
noch
für
andere
Übersetzungen
mache,
Deutschunterricht
gebe
und
ab
und
zu
putzen
gehe,
wenn ich die Miete noch nicht zusammen habe.
Heute
aber
nehme
ich
mir
frei
und
erobere
mir
erneut
die
geliebte
Stadt.
Alle
vertrauten
Orte
unter
unvertrautem
Weiß.
So
vieles,
täglich
gesehen,
noch
nie
Gesehenes.
Bei
jedem
Schritt
knirscht
es
unter
meinen Füßen.
Aber
man
muss
höllisch
aufpassen.
In
die
Wege
Venedigs
sind
immer
wieder
Marmorstreifen
einge-
lassen,
die
man
nicht
sieht,
wenn
der
Schnee
alles
abdeckt,
die
aber
auf
eine
ganz
andere
Art
schlüpfrig
werden
als
der
übliche
Straßenbelag.
Zweimal
rutscht
mir
ein
Fuß
auf
dieser
plötzlich
glatten
Fläche
weg,
während
der
Rest
von
mir
zurückbleibt
und
ich
mich
nur mit Mühe auf den Füßen halten kann.
Also
pflüge
ich
ein
bisschen
vorsichtiger
durch
den
Schnee,
bis
der
allmählich
vergeht
und
schließlich
nur
noch
rußiger
Matsch
übrigbleibt.
Vergänglichkeit
ist
ein
Teil
des
Wunderbaren.
Glücklich
und
voll
von
den
romantischsten
Bildern
mache
ich
mich
schließlich
auf
den Heimweg.
Als
ich
in
unserem
Viertel
ankomme,
ist
es
schon
dunkel.
Und
dann
beginnt
es
noch
einmal
zu
schneien.
Ich
fange
die
Flocken
mit
meinen
Händen
und
auf
meiner
Zunge.
Ich
spüre
ihr
Federgewicht
auf
meinen
Augenlidern.
Ich
wirbele
mit
im
Tanz
der
Schnee-
flocken.
Im
Schein
der
Straßenlaterne
lächeln
Vorüber-
gehende
über
mich.
Oder
sie
lächeln
mich
an.
Ich
bin
hier
zu
Hause
und
sie
kennen
mich.
Fremde
kommen
selten
in
unseren
Teil
der
Stadt,
und
im
Winter
sind
wir
ganz unter uns.
Ich
laufe
die
Treppen
hinauf,
freue
mich
auf
eine
heiße
Dusche.
Im
zweiten
Stock
gibt
es
mal
wieder
kein
Licht.
Die
Lichtleitung,
die
vor
historischen
Zeiten
an
den
Rückwänden
der
Häuser
entlang
gespannt
worden
ist,
bricht
immer
wieder
an
derselben
Stelle,
und
viele
machen
die
alte
Dame
zweite
Tür
links
dafür
verantwortlich,
die
nicht
verstehen
will,
dass
es
keine
Wäscheleine
ist,
was
da
unter
ihrem
Küchenfenster
hängt.
Mein
Gasofen
bringt
seine
unmittelbare
Umgebung
zum
Glühen,
aber
die
ungedämmten
Wände
und
die
alten
Fenster
lassen
die
Wärme
auch
gleich
wieder
raus.
In
eine
Decke
gewickelt
und
mit
einer
Tasse
dampfenden
Tees
hocke
ich
nach
der
Dusche
in
der
aufgewärmten
Mitte
des
Zimmers
und
sehe
zu,
wie
der
Schnee auf meine Terrasse fällt.
Dann
bemerke
ich
plötzlich,
dass
sich
in
der
Nachbarwohnung
etwas
tut.
Die
Vorhänge
in
dem
Raum,
von
dem
aus
man
den
Balkon
betreten
kann,
sind
zurückgezogen.
Das
Licht
schneidet
den
Schatten
eines
Menschen
aus.
Schließlich
öffnet
sich
die
Tür
zum Balkon und er wagt einen Schritt nach draußen.
Ich
habe
den
Eindruck,
es
müsse
sich
um
einen
Mann
handeln,
aber
ich
könnte
nicht
sagen,
warum
es
mir
so
erscheint.
Der
Mensch
also,
der
vielleicht
ein
Mann
ist,
tritt
an
das
Gitter,
schaut
auf
den
Platz
hinunter
und
hebt
dann
das
Gesicht
zum
Himmel,
als
fange auch er die herabfallenden Flocken mit Freude.
Am
nächsten
Morgen
male
ich
Muster
in
den
Schnee,
der
in
der
vergangenen
Nacht
auf
meine
Terrasse
gefallen
ist.
Ich
höre,
dass
sich
die
Tür
der
anderen
Wohnung
erneut
öffnet,
aber
ich
drehe
mich
nicht
um.
Der
Nachbar
hustet,
als
wolle
er
auf
sich
aufmerksam
machen.
Als
ich
schließlich
zu
ihm
auf-
schaue,
starrt
er
in
den
Himmel,
als
wäre
es
ihm
pein-
lich.
Ich
rufe
ihm
ein:
„Buon
Giorno!“
zu.
Er
wirft
mir
nur
einen
Blick
zu,
nickt
kurz
und
ver-schwindet,
als
hätte
ich
ihn
vertrieben.
Die
Tür
schließt
sich
hinter
ihm.
‚Das
ist
aber
mal
ein
schöner
Mann!‘
geht
mir
durch
den
Kopf.
Einer,
der
einem
alten
Gemälde
entstiegen
sein
könnte.
Groß
und
wohlgeformt,
soweit
ich
sehen
kann.
Dunkle
Locken,
dunkle
Augen,
aber
dennoch
geht
etwas
Helles,
Strahlendes
von
ihm
aus.
So,
als
brenne
in
ihm
ein
silbernes
Licht.
Wie
das
Licht
der Straßenlaternen im fallenden Schnee.
Signor
Marzis
Kunsthandel
am
Campo
San
Stefano
ähnelt
vielleicht
mehr
einem
Museum
als
einem
Laden.
Da,
wo
das
Publikum
unter
Glockengeläut
eintritt,
steht
nur
eine
diskrete
Theke
in
einer
gut
beleuchteten
Ecke.
Der
Rest
des
Raumes
dient
den
Kunstwerken,
die
an
den
Wänden
hängen,
in
Vitrinen
vor
jedem
Zugriff
sicher
sind
oder
im
Licht
von
Deckenspots
stehen,
so
dass
der
Betrachter
genug
Raum hat, sich ihnen von allen Seiten zu nähern.
Hinter
einem
Durchgang
liegen
die
anderen
Räume,
in
denen
der
Hauptteil
der
Geschäfte
statt-
findet:
das
Büro
von
Marzi,
das
allgemeine
Büro,
in
dem
alle
sitzen,
die
hier
etwas
zu
tun
haben,
wenn
sie
gerade
einmal
anwesend
sind,
Toiletten,
das
Lager
und
der
Raum,
der
gesichert
ist
wie
ein
Safe,
und
nachts
auch
als
solcher
fungiert.
Und
unsere
wich-
tigste
Unterstützung
bei
der
Arbeit:
die
Kaffee-
maschine und der Kühlschrank!
Der
Kunsthandel,
so
wie
ihn
Signor
Marzi
betreibt,
ist
ein
diskretes
und
geheimnisvolles
Geschäft,
welches
mich
manchmal
an
Schmuggelei
erinnert,
obwohl
jeder
außer
Marzi
selbst
diesen
Vergleich
weit
von
sich
weisen
würde.
Aber
es
geschieht
nicht
selten,
dass
eine
geflüsterte
Nachricht
eintrifft,
über
die
vage
Möglichkeit,
dass
irgendwo,
in
einer
Haushaltsauf-
lösung,
einem
Notverkauf,
auf
dem
Lande,
wo
man
sich
nicht
auskennt,
ein
seltenes
Objekt
zu
finden
sein
könnte.
Ein
Kunstwerk,
das
als
verloren
galt
oder
von
dessen
Existenz
keiner
wusste.
Dann
setzt
sich
Marzi
in
Gang
oder
er
schickt
einen
seiner
Leute,
um
Stunden
oder
Tage
später
zurückzu-kehren,
mit
Beute
oder mit leeren Händen.
Signor
Marzi
kümmert
sich
persönlich
nur
um
einige
wenige
ausgesuchte
Objekte.
Er
liebt
es,
wie
ein
Spürhund
einem
Duft
zu
folgen
und
buchstäblich
Schätze
aus
dem
Dreck
zu
wühlen,
wofür
er
ein
gutes
Händchen
hat.
Den
Rest
besorgen
seine
Männer:
Francesco und Lorenzo.
Francesco
ist
eigentlich
viel
zu
alt,
um
noch
beim
Vornamen
gerufen
zu
werden,
aber
es
war
halt
immer
so.
Er
ist
schon
lange
Rentner.
Aber
er
hat
bereits
für
Marzis
Vater
gearbeitet
und
wird
nur
noch
ab
und
zu
dazu
gerufen,
wenn
es
sich
um
eine
ältere
Witwe
han-
delt,
mit
der
komplizierte
Verhandlungen
geführt
wer-
den müssen.
Lorenzo
ist
Francescos
offizieller
Nachfolger
und
auch
irgendwie
verwandt
mit
ihm.
Er
ist
meist
unter-
wegs,
entweder
um
potentielle
und
tatsächliche
Kun-
den
bei
guter
Laune
zu
halten
oder
um
Bestände
in
Augenschein
zu
nehmen
und
abzuschätzen,
ob
sich
der
Ankauf
lohnen
würde.
Von
seiner
Berufsausbildung
her
ist
er
ein
Kaufmann.
Was
er
vom
Kunsthandel
versteht, hat er vor allem bei Marzi gelernt.
Im
Laden
beschäftigt
Marzi
noch
zwei
Halbtagskräfte,
die
vor
allem
Sekretariats-
und
Buch-
haltungsarbeiten
erledigen.
Sie
empfangen
auch
die
Kunden,
vor
allem
um
festzustellen,
ob
diese
ernst
zu
nehmen
sind.
Falls
das
der
Fall
ist,
rufen
sie
den
Chef
oder
Lorenzo,
falls
er
gerade
einmal
da
ist.
Wenn
es
gar
nicht
anders
geht,
rufen
sie
mich.
Geht
es
nur
um
einen
schnell
abzuschließenden
Verkauf,
dürfen
sie
selbst tätig werden.
Ab
und
zu
beauftragt
Marzi
natürlich
auch
externe
Sachverständige,
die
je
nach
Auftrag
bezahlt
werden.
Zu
denen
kann
ich
mich
noch
nicht
zählen,
mit
meinen
paar
Semestern
Italienischer
Kunstgeschichte.
Aber
ich
arbeite
hart
daran,
meine
Kenntnisse
zu
erweitern
und Marzi beobachtet es mit Wohlwollen.
Im
Grunde
diene
ich
ihm
stundenweise
als
‚Mädchen
für
alles‘
und
arbeite
vor
allem
als
Übersetzerin.
Marzi
selbst
spricht
selbstverständlich
mehrere
Sprachen,
jedoch
so,
dass
seine
Klugheit
es
ihm
gebietet,
seinen
natürlichen
Charme
nur
in
per-
sönlichen
Begegnungen
spielen
zu
lassen,
und
sich
schriftlich
lieber
unzweideutiger
auszudrücken.
Meine
fachlichen
Kenntnisse
in
verschiedenen
Sprachen
sind
dafür
ausreichend
und
wenn
nicht,
so
ist
er
immer
bereit, mir zu erklären, worum es geht.
Manchmal
denke
ich,
er
beschäftigt
mich
auch
deshalb,
weil
er
ein
bisschen
Mitleid
mit
mir
hat,
und
es
genießt,
ein
solch
armes
Geschöpf
wie
mich
am
Leben
zu
halten.
Das
mag
auch
daran
liegen,
dass
er
zwar
zwei
Söhne
hat,
aber
irgendwie
eine
Tochter
vermisst.
Tatsächlich
ist
er
ein
fast
immer
korrekter
Arbeitgeber,
der
sich
nur
in
schwachen
Stunden
einen
Anfall
von
feinem
Humor
gestattet
oder
auch
einmal
einen Wutanfall. Je nachdem.
Hin
und
wieder
wage
ich
es,
ihn
darauf
auf-
merksam
zu
machen,
dass
ich
ihm
noch
viel
nützlicher
sein
könnte,
wenn
er
sich
dazu
durchringen
könnte,
mir
eine
feste
Stelle
zu
geben,
aber
auf
diesem
Ohr
ist
er
so
gut
wie
taub.
Mir
geht
es
ja
nicht
nur
um
das
Gehalt,
obwohl
ich
schon
lange
nicht
mehr
die
Nase
über
die
Sicherheit
eines
festen
Einkommens
rümpfen
würde.
Es
ist
auch,
weil
ich
finde,
dass
es
für
mich
langsam
Zeit
wird,
mir
eine
Berufsbezeichnung
zuzu-
legen,
anstatt
mich
von
zufälligem
Job
zu
zufälligem
Job
zu
hangeln.
Ein
Magister
in
Romanistik
ist
noch
nicht
einmal
als
Titel
besonders
eindrucksvoll,
als
Berufsbeschreibung ist er völlig untauglich.
Im
Handel
mit
Kunst
verbände
sich
mein
Interesse
für
Italien
und
für
die
italienische
Kunst
mit
einer
durchaus
praktischen
Seite.
Da
geht
es
einmal
darum,
etwas
zu
entdecken,
was
sehr
spannend
sein
kann,
und
andererseits
darum,
welche
Preise
sich
erzielen
lassen,
als
Käufer
oder
als
Verkäufer.
Ich
könnte
mir
einen Berufsweg im Kunsthandel absolut vorstellen.
Aber
so
wie
die
Dinge
liegen,
stehe
ich
ihm,
wie
jedem
anderen
auch,
nur
stundenweise
zur
Verfügung.
Romantiker
nennen
das:
Freiheit.
Aber
es
hat
wenig
davon.
Immer
wieder
Jobs
zu
finden,
ist
nicht
einfach,
und
obwohl
sich
meine
Auftraggeber
der
Freiheit
erfreuen,
mich
zu
nehmen
oder
mich
abzulehnen,
kann
ich
mir
den
Luxus,
einen
Auftrag
abzulehnen,
nur
selten leisten.
Heute
mache
ich
die
monatliche
Auswertung
internationaler
Zeitschriften.
Was
Signor
Marzi
interes-
siert,
ist
jede
Art
von
Hinweis,
je
versteckter,
desto
besser,
in
denen
Kunstwerke
nicht
ganz
gewisser
Herkunft
gemeldet
werden,
ebenso
wie
Veröffentli-
chungen
über
halbbekannte
oder
unbekannte
Künstler.
Denn
Signor
Marzi
handelt
nicht
nur
mit
Kunstwerken,
er
sammelt
auch
selbst,
wobei
das
Bedürfnis
nach
ästhetischem
Genuss
und
gewinnbringender
Investi-
tion sich durchaus die Waage halten.
Als
ich
von
der
Arbeit
nach
Hause
komme,
ist
es
schon
dunkel.
Auf
der
Dachterrasse
liegt
immer
noch
Schnee,
aber
er
ist
zusammengebacken.
Keine
lockere
Flockigkeit
mehr.
In
der
Nachbarwohnung
sind
die
Vorhänge
noch
nicht
zugezogen
und
so
kann
ich
den
neuen
Nachbarn
in
einem
Zimmer
sehen,
das
eine
Art
Wohnzimmer
oder
Salon
zu
sein
scheint.
Im
Licht
der
Deckenlampe
steht
er
dort.
Seine
Aufmerk-
samkeit
ist
auf
einen
Punkt
konzentriert,
der
sich
meinem
Blick
entzieht,
aber
ich
habe
nicht
den
Eindruck,
als
gelte
sein
Interesse
einem
dort
Sitzen-
den.
Im
Gegenteil,
er
erweckt
den
Eindruck,
auf
eine
sehr
grundsätzliche
Weise
allein
zu
sein,
und
ich
fühle
so
etwas
wie
Mitleid,
wie
man
es
mit
einem
Tauben
oder Blinden empfindet.















